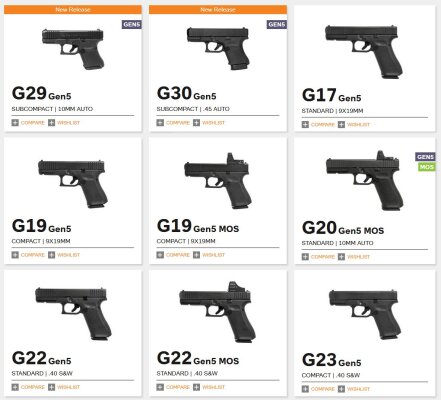Deutschland verfügt über ein äußerst komplexes Waffenrecht, das in den letzten Jahren immer unübersichtlicher geworden ist. Angesichts einer EU-weiten Harmonisierung der Feuerwaffenrichtlinie stellt sich die Frage, ob dies als Gelegenheit genutzt werden kann, um das deutsche Waffenrecht grundlegend zu vereinfachen. Dabei geht es nicht um eine leichtere Verfügbarkeit von Waffen, sondern um effizientere Verwaltung, bessere Vollziehbarkeit und höhere Rechtssicherheit – für legale Waffenbesitzer ebenso wie für Behörden. Im April 2025, nach der Bundestagswahl, rückt dieses Thema verstärkt in den Fokus.
Ausgangslage: Ein komplexes und unübersichtliches Waffenrecht
Das deutsche Waffenrecht gilt als eines der strengsten der Welt ist aber auch hochkomplex und schwer überschaubar. Seit der umfassenden Neufassung des Waffengesetzes im Jahr 2002, die eigentlich für mehr Übersichtlichkeit sorgen sollte, wurde das Gesetz dutzende Male geändert und erweitert – zuletzt durch das dritte Waffenrechtsänderungsgesetz 2024 („Entschließung des Bundesrates „Messerkriminalität wirksam bekämpfen und Novelle des Waffenrechts zügig voranbringen““ bundesrat.de). Was einst verständlich formuliert war, hat sich zu einer schwerfälligen Rechtsmaterie entwickelt, mit der selbst Waffenbehörden und Polizei zu kämpfen haben. So ist das Waffengesetz mit all seinen Anlagen und Verweisen heute eine der unübersichtlichsten Rechtsmaterien (vergleichbar fast nur mit dem Betäubungsmittelrecht) (interessant hierzu die „Fragen an die Parteien zur Bundestagswahl 2025“ des VDB vdb-waffen.de).
Diese Unübersichtlichkeit führt zu widersprüchlichen Auslegungen und Unsicherheiten. Ein Beispiel ist § 42a WaffG: Hier geht es um das Führen von Anscheinswaffen sowie Hieb- und Stoßwaffen (vor allem bestimmten Messern) in der Öffentlichkeit. Ob ein bestimmtes Messer unter ein generelles Mitführverbot fällt, nur unter ein Umgangsverbot oder gar nicht vom WaffG erfasst ist, lässt sich für Außenstehende oft kaum erkennen. Selbst Fachleute sind sich in der Interpretation nicht immer einig.
Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Erwerbsstreckungsgebot: Sportschützen dürfen in der Regel innerhalb von sechs Monaten nicht mehr als zwei Schusswaffen erwerben (§ 14 Abs. 3 WaffG) – eine Regelung, die gut gemeint ist, in der Praxis aber als bürokratische Hürde empfunden wird. Zudem wurde 2020 eingeführt, dass Sportschützen alle fünf Jahre ihre Bedürfnisberechtigung erneut nachweisen müssen, was zusätzlichen Verwaltungsaufwand erzeugt (§4 Abs. 4 WaffG). Solche Vorschriften tragen zur Gesetzesdichte und Bürokratie bei, ohne dass zwingend ein Sicherheitsgewinn erkennbar ist.
Die Folge dieser Entwicklung: Widersprüche und Vollzugsprobleme. Gerichte müssen zunehmend Detailfragen klären, weil das Gesetz Lücken oder Unklarheiten lässt. So stellte etwa das Oberverwaltungsgericht NRW im August 2023 fest, dass die gesetzlichen Vorgaben zur Aufbewahrung von Waffenschrankschlüsseln nicht klar geregelt waren. Diese Entscheidung sorgte bei Behörden wie legalen Waffenbesitzern für Verunsicherung, bis es als neue Auslegungshilfe diente. Insgesamt entsteht ein Flickenteppich von Vorschriften und Gerichtsurteilen, der kaum noch zu überblicken ist.
Angesichts dieser Probleme fordern sowohl Fachleute als auch die Politik eine Vereinfachung und Neufassung des Waffenrechts. Der Bundesrat hat im Juni 2024 ausdrücklich eine grundlegende Überarbeitung und Vereinfachung der waffenrechtlichen Vorschriften als „dringend geboten“ bezeichnet. Ziel muss es sein, das Waffenrecht wieder verständlicher, übersichtlicher und praxisgerechter zu gestalten – ohne die erreichten Sicherheitsstandards zu senken. Siehe hierzu auch die Initiative „Next Guneration: Operation Reset“ vom VDB https://fight4right.de/)
EU-Harmonisierung als Katalysator für Reformen
Die Europäische Union arbeitet seit Jahren an einer Harmonisierung des Waffenrechts, um innerhalb des Binnenmarktes einheitliche Mindeststandards zu gewährleisten. Zentral ist hier die EU-Feuerwaffenrichtlinie (heute kodifiziert als Richtlinie (EU) 2021/555), die gemeinsame Mindestvorschriften für den Erwerb, Besitz und Transfer von zivilen Schusswaffen vorgibt. Alle EU-Mitgliedstaaten mussten diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Dennoch bestehen weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern, da es jedem Staat frei steht, strengere Regeln zu erlassen (en.wikipedia.org). So hat Deutschland in vielen Bereichen über die EU-Vorgaben hinausgehende Restriktionen (z. B. bei Magazinbegrenzungen oder der erwähnten Erwerbsstreckung). Eine echte EU-weite Harmonisierung ist also noch nicht voll erreicht – erst Ende 2024 leitete die EU-Kommission sogar Vertragsverletzungsverfahren gegen Malta und die Niederlande ein, da diese die Richtlinie noch nicht vollständig umgesetzt hatten (vdb-waffen.de).
Trotzdem bietet die EU-Politik einen Impuls für Veränderungen. Die Europäische Kommission und das Parlament verfolgen mit der Harmonisierung zwei Ziele: Sicherheit erhöhen und Bürokratie abbauen. So wurde im März 2024 politisch eine überarbeitete EU-Feuerwaffenverordnung auf den Weg gebracht, die Schlupflöcher für den illegalen Waffenhandel schließen und zugleich den legalen Waffenhandel erleichtern soll (consilium.europa.eu). Hierzu sollen u. a. gemeinsame Vorschriften, standardisierte Lizenzverfahren und koordinierte Kontrollen in allen EU-Ländern beitragen. Klare, einheitliche Kategorien von Feuerwaffen (A, B, C) sind bereits EU-weit definiert, was den rechtlichen Rahmen vereinheitlicht. Für Deutschland bedeutet dies beispielsweise, dass die Klassifizierung von Waffen (verboten, genehmigungspflichtig, meldepflichtig) bereits im EU-Kontext vorstrukturiert ist.
Besonders interessant im Hinblick auf Bürokratieabbau sind die Pläne zur Digitalisierung und Vereinfachung von Verfahren. Die EU will ein neues elektronisches Lizenzierungssystem einführen, das mit den nationalen Waffengenehmigungssystemen verknüpft wird (consilium.europa.eu). Dadurch sollen Anträge – etwa für den grenzüberschreitenden Waffentransfer oder den Europäischen Feuerwaffenpass – schneller und medienbruchfrei bearbeitet werden können. Rat und Parlament betonen, dass Transaktionen zügig ablaufen können müssen, ohne die Sicherheit der Bürger zu beeinträchtigen (consilium.europa.eu). Konkret sollen die Verfahren für Jäger, Sportschützen und Waffenaussteller vereinfacht und digitalisiert werden, um Zeit zu sparen und Genehmigungen zu beschleunigen (consilium.europa.eu). Dies zeigt: EU-Harmonisierung kann ein Motor sein, veraltete und aufwendige Verwaltungsabläufe zu modernisieren.
Bürokratieabbau statt Lockerung der Sicherheitsstandards
Entscheidend ist der richtige Fokus bei einer Reform: Es geht nicht darum, die strengen deutschen Waffengesetze inhaltlich aufzuweichen oder Waffen leichter verfügbar zu machen. Vielmehr soll das existierende Schutzniveau effizienter erreicht werden. Alle legalen Waffenbesitzer in Deutschland – ob Sportschützen, Jäger oder Sammler – durchlaufen bereits heute strenge Zuverlässigkeitsprüfungen, Bedürfnisnachweise und Schulungen. Diese bewährten Sicherheitsmechanismen bleiben unberührt. Eine Vereinfachung des Waffenrechts zielt stattdessen darauf ab, Doppelungen, unnötige Formalitäten und unklare Regelungen abzubauen, sodass legale Waffenbesitzer und Behörden gleichermaßen entlastet werden.
Dabei ist wichtig zu betonen, dass mehr Übersichtlichkeit und weniger Bürokratie auch der Sicherheit zugutekommen. Wenn Regeln klar formuliert sind, können sich alle Beteiligten – von der Waffenbehörde bis zum Sportschützen – besser daran halten. Die Vollzugsbehörden können ihre Ressourcen gezielter einsetzen, anstatt Zeit in Auslegungsfragen oder Verwaltungskleinkram zu investieren. Rechtssicherheit bedeutet, dass legale Waffenbesitzer genau wissen, was erlaubt ist und was nicht, und Behörden im Zweifelsfall eindeutige Handhaben haben. So wird der gesetzestreue Waffenbesitz erleichtert, während gleichzeitig der Fokus auf der Bekämpfung illegaler Waffen liegen kann, die das weitaus größere Sicherheitsrisiko darstellen. Deutschland kann hierbei von der EU-Harmonisierung profitieren, indem es sinnvolle europäische Standards übernimmt und überflüssige nationale Sonderwege beendet.
Die Feuerwaffenrichtlinie und begleitende EU-Maßnahmen bieten also eine Chance, deutsche Vorschriften zu straffen. Beispielsweise könnten EU-weit einheitliche Kennzeichnungs- und Registrierpflichten dazu führen, dass parallele nationale Vorgaben reduziert werden. Auch die gegenseitige Anerkennung von Waffenbesitzkarten oder Jagdscheinen innerhalb der EU könnte perspektivisch Bürokratie abbauen – selbstverständlich nur nach sorgfältiger Prüfung der Sicherheitsäquivalenz. Wichtig ist, dass eine deutsche Reform in enger Abstimmung mit europäischen Initiativen erfolgt, um keine neuen Brüche zu erzeugen, sondern ein kohärentes Gesamtsystem für den legalen Waffenbesitz zu schaffen.
Nutzen für Waffenhändler, Sportschützen, Jäger und Polizei
Eine vereinfachte Rechtsstruktur käme allen beteiligten Gruppen zugute. Waffenhändler – vom Büchsenmacher bis zum großen Fachhandel – leiden derzeit unter erheblichem Verwaltungsaufwand. Jede Waffenüberlassung erfordert umfangreiche Dokumentation, verschiedene Genehmigungen und strikte Lagerungsauflagen. Klarere Regeln und ein digitalisiertes Melde- und Genehmigungssystem würden Geschäftsabläufe beschleunigen. Etwaige EU-weit einheitliche Verfahren könnten den Handel über die Landesgrenzen hinweg erleichtern, ohne dass Händler befürchten müssen, unabsichtlich aus Unkenntnis ausländischer Vorschriften dagegen zu verstoßen. Die geplanten EU-Regeln sehen vor, dass legaler Handel schneller und einfacher abgewickelt werden kann (consilium.europa.eu)
– das gibt der Branche Hoffnung auf weniger Bürokratie in der Zukunft.
Für Sportschützen und Jäger bedeutet Bürokratieabbau vor allem weniger Hürden im legalen Waffenbesitz und -erwerb, nachdem alle Sicherheitsauflagen erfüllt sind. Ein typischer Sportschütze muss Mitglied in einem Schützenverein sein, ein Bedürfnis nachweisen, Lehrgänge besuchen, eine Zuverlässigkeitsprüfung bestehen und regelmäßig seine Schießnachweise führen – erst dann erhält er Waffenbesitzkarten für einzelne Waffen, und sogar dann greift noch die erwähnte Erwerbsstreckung. Eine Vereinfachung könnte bedeuten, dass Verfahren effizienter gestaltet werden (z. B. Online-Antragstellung, gebündelte Genehmigungen) und die Verwaltungsfristen verkürzt werden. Wichtig: Es geht nicht um eine Aufweichung von Eignungs- oder Zuverlässigkeitsprüfungen – im Gegenteil, seriöse Schützen und Jäger haben ein Interesse an klaren Regeln, damit ihr Hobby bzw. ihre Tätigkeit nicht durch schwarze Schafe oder bürokratische Pannen in Verruf gerät. Durch EU-Vorgaben wie den Europäischen Feuerwaffenpass wird es für sie zudem einfacher, legal Waffen zu Veranstaltungen oder Jagdreisen ins Ausland mitzunehmen, da die jeweiligen Behörden ein einheitliches Dokument anerkennen – Verwaltungszeiten von teilweise mehreren Monaten für einen Eintrag im Europäischen Feuerwaffenpass haben jedoch das Potential die daraus entstehenden Vorteile zu negieren.
Auch die Polizei und Ordnungsbehörden profitieren von einem entrümpelten Waffenrecht. Weniger komplizierte Regelungen bedeuten, dass Kontrollen effizienter durchgeführt werden können. Dank des bereits bestehenden Nationalen Waffenregisters (NWR), das alle genehmigungspflichtigen Waffen und deren Besitzer zentral digital erfasst, können Vollzugsbehörden bereits heute im Einsatz schnell prüfen, ob eine Person berechtigt ist, eine Waffe zu besitzen. Eine zukünftige EU-weite Verzahnung vergleichbarer Systeme könnte diese Prozesse zusätzlich beschleunigen – insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten. Zudem reduziert klare Gesetzgebung den Schulungsaufwand der Behörden: Polizisten und Sachbearbeiter müssen sich nicht durch widersprüchliche Kommentare kämpfen, sondern können auf eindeutig geregelte Sachverhalte zurückgreifen. Letztlich erhöht dies die Vollzugsdichte bei echten Problemfällen – etwa dem Aufspüren illegaler Waffen oder dem Entziehen von waffenrechtlichen Erlaubnissen bei Gefährdern – weil weniger Ressourcen in Formalia gebunden sind.
Fazit
Die Harmonisierung des Waffenrechts auf EU-Ebene bietet für Deutschland eine willkommene Gelegenheit, das eigene Waffenrecht zu entrümpeln. Die bestehenden Herausforderungen – von überbordender Gesetzesdichte über Verwaltungshürden bis zu teils widersprüchlichen Regelungen – sind anerkannt und werden mittlerweile sogar von offiziellen Stellen kritisiert. Ein einfacheres, moderneres Waffenrecht würde den legalen Waffenbesitzern (Sportschützen, Jägern, Waffenhändlern…) den Alltag erleichtern, ohne die Kontrolle zu verlieren, und den Behörden die Arbeit deutlich vereinfachen.
Wichtig ist dabei eine wissenschaftlich fundierte und objektive Herangehensweise: Welche Regelungen tragen wirklich zur öffentlichen Sicherheit bei, und wo ist Bürokratie zum Selbstzweck geworden? Die EU-Vorgaben, etwa in Form der Feuerwaffenrichtlinie und der neuen Feuerwaffenverordnung, liefern einen Rahmen, in dem sich diese Fragen beantworten lassen. Sie setzen einheitliche Standards und ermöglichen den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten. Deutschland kann diese Impulse nutzen, um das nationale Waffenrecht strukturell zu vereinfachen – zum Nutzen aller rechtstreuen Beteiligten und der inneren Sicherheit insgesamt. Schließlich geht es nicht um „mehr Waffen“, sondern um bessere Regeln.